Eine hohe, fensterlose Tür mit einem einfachen Schloss und einer unpersönlichen, kalten Klinke. Wie wird sie wohl zu öffnen sein? Leicht, auch für ältere Semester noch passierbar? Oder drückt man die Klinke, stemmt sich dann mit dem ganzen Körpergewicht gegen die Tür, erblickt eine starke Feder weit oben am Ende der Tür und klemmt sich beim Loslassen die Hose ein, schlägt der nachfolgenden Person die Tür vor der Nase zu?
Es ist eine von diesen Wartsaaltüren, die einem den Weg versperren, das Durchkommen erschweren, einen zur Umkehr zwingen, weil sie einfach so mühsam zu öffnen sind, sich hingegen nach einem schnappend schnell schliessen.
Hat man sich erst einmal hindurchgezwängt, schleicht man in den hohen Saal und steht dort betreten in einer Ecke des öden Raumes. Die Zeit steht still, die Uhr an der abblätternden Wand tickt. Jetzt erst bemerkt man die leeren Bänke an den Wänden und setzt sich anständig hin, faltet die Hände und wird gegen den eigenen Willen etwas rot im Gesicht. Ob das die glotzenden Wartesaalfiguren bewirken, die einen mit hängenden Mundwinkeln, müden Augen und längst aus der Mode gekommenen Frisuren mustern? Verstohlen dreht man den Ring am Finger, schlägt dann nervös ein Bein über das andere und nimmt eine zusammengesunkene, höchst unbequeme Stellung ein. Verharrt darin, wie eine zur Salzsäule erstarrte Kreatur.
Gegenüber wird ein Heft aus einer alten Tasche gekramt, man vernimmt das Rascheln der Seiten und meint plötzlich, unangenehme Blicke auf sich zu spüren. Komisch wird einem zumute, verlegen fährt man sich durchs Haar und setzt sich die Brille zurecht, ohne jedoch aufzublicken.
Die Uhr tickt; wie gerne würde man aufschauen, erführe, dass man nicht mehr lange zu warten hätte, bald wieder ein freier, unbekümmerter Mensch sein könnte. Das Heft wird zur Seite gelegt, man schaut schnell auf, um in einen weit geöffneten Schlund zu blicken. Ein ewig dauerndes Gähnen des Gegenübers. Gebannt beobachtet man, obwohl man lieber wegschauen würde. Doch bleibt der Blick haften auf diesem von Runzeln, Tälern, Furchen und einem schwarzen Loch besetzten Gesicht. Dann wendet man sich ab und tut so, als ob man nichts dergleichen gesehen hätte.
Endlich traut man sich, ein wenig umherzuschauen, den Raum in Augenschein zu nehmen. Etwas lockerer und aufrechter sitzt man da, doch immer noch angespannt und jederzeit bereit, sich wieder in eine verkrampfte Lage zu flüchten, den Blick zu Boden zu werfen und den andern seine Unfähigkeit, ja nachgerade kapitulierende Nichtigkeit zu demonstrieren. Es müden einen die vergilbten Wände an, die nichts als bodenlose Langeweile zu vermitteln haben. Verschlafene, verlorene Bilder, die nächstens aus dem Rahmen zu fallen drohen hängen schief an den eintönigen Wartesaalmauern. Die Decke, deren altersschwacher Putz zu bröckeln beginnt, drückt wie eine zentnerschwere Platte auf den Kopf. Vereinzelte Pflanzen vegetieren trocken vor sich hin; jede Feuchtigkeit wird durch die lauwarmen Heizkörper langsam der Erde entzogen. Neben der Uhr, die wie in jedem Wartesaal unerreichbar in der Höhe thront, sind die Fenster. Die langen, sich über die ganze Fensterlänge ziehenden Regentropfenbahnen sind angetrocknet, von Staub und Dreck hervorgehoben. Der Blick nach draussen ähnelt jenem durch das dickste Brillenglas. Verschwommen nimmt man farbige Flecken wahr, die sich davor bewegen. Die Luft im Raum scheint immer dieselbe zu sein, alles hier drin verändert sich nie, der Raum ist und bleibt derselbe in alle Ewigkeit: Horror.
Mittlerweile sitzt man gerade, fühlt sich schon Gegenstand, da geht die Türklinke. Die Tür öffnet sich langsam, zwei schlurfende, abgetragene Schuhe dringen hinein in den zeitlosen Wartesaal. Nun hebt man selbst den Kopf und fixiert diese Figur, studiert ihre Aufmachung und glotzt ihr mit unverhohlener Gleichgültigkeit und doch spürbarer Überheblichkeit ins Gesicht, sodass diese den Mut verlässt und sich elend auf einen der Bänke niederlässt. Man meint, man könne ihren Atem hören, versteht ganz und gar nicht, warum dieser Mensch nur so verkrampft dasitzen kann, ein abgekämpfter Gesichtsausdruck, den Blick gesenkt. Man bemerkt voller Mitleid die steigende Röte in seinem Gesicht und schaut schliesslich peinlich berührt zum Abfalleimer, der einsam und verlassen in einer Ecke den Abend abwartet.
Man schaut auf die Uhr und steht endlich auf. Zieht die Türe auf und lässt sie laut in die Falle schnappen. Dann, zum Gebäude hinaus, zweimal tief geatmet. Wie gehetzt blickt man nochmals zurück, um sich zu vergewissern, dass der unheimliche Raum nicht hinter einem her ist. Ein Schauer fährt einem über die Haut. Doch Glück gehabt, der Wartsaal bleibt stoisch, wo er ist. Mit schnellen Schritten erreicht man erlöst den Zug und jagt dann aufatmend ins Leben zurück.
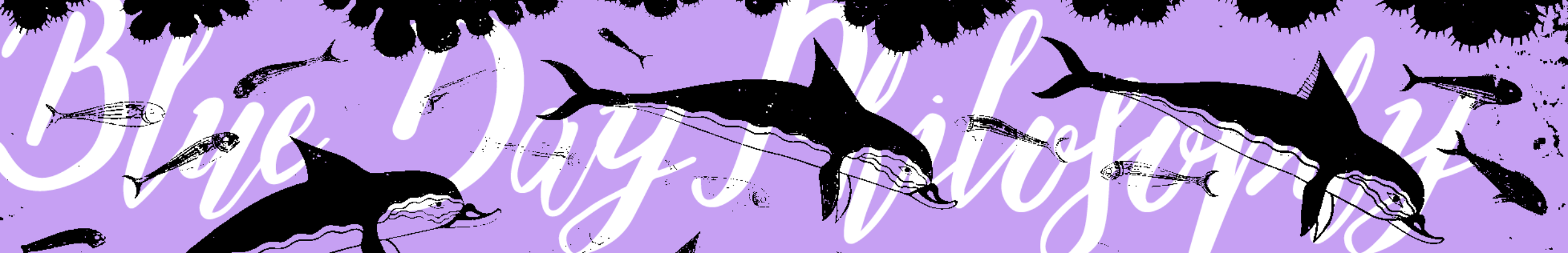
Liebe Manuela
das ist wohl nicht dir heute so ergangen?! In einer Praxis?
Eine solche Atmosphäre ist nicht zu ertragen. Ich kenne das und das musss thematisiert werden. So verlässt man die Praxis in schlechterem Zustand als beim Ankommen.
Liebe Sigrid
Ist meine Beobachtung, hingegen nicht in einer Praxis; wobei Du schon recht hast, ähnliche Gefühle sind mir in Praxen auch schon hochgekommen…